
NEUHEITEN
NEUHEITEN der letzten 12 Monate
IN VORBEREITUNG
ARCHIV
AUSZEICHNUNGEN
CDs
SACDs
LPs
MCs
KATALOGNUMMERN
|
|
ORFEO International – Pressetexte
Wichtige Veröffentlichungen kurz vorgestellt
September 2017
Salzburger Festspieldokumente 2017
Je weiter die Zeit fortschreitet, umso weiter reicht die Zeitspanne zurück, aus der Aufnahmen existieren. Sehr früh verbanden sich die seit 1920 stattfindenden Salzburger Festspiele mit dem neuen Medium Rundfunk – „Festspielgeschichte ist Rundfunkgeschichte“, so Gottfried Kraus. Schon 1925 wurde ein kompletter Don Juan (von Mozart) unter Karl Muck übertragen, in den nächsten Jahren kontinuierlich mehr Vorstellungen in mehr Länder, und schon von 1931 datiert auch die erste Dokumentation auf physischem Tonträger, ein Mozart-Requiem auf Schellack (Orfeo C 396951). Seit 1992 entschieden sich die Festspiele, gemeinsam mit dem ORF aus den Archiven besonders wertvolle und historisch relevante Aufnahmen als „Salzburger Festspieldokumente“ zu veröffentlichen, und ORFEO ist stolz, einen großen und nachhaltigen Anteil daran zu haben – ORFEO hält als einzige beteiligte Firma gemäß seiner Philosophie alle veröffentlichten Titel lieferbar. Für eine Institution wie die Salzburger Festspiele mit ihrem Anspruch, vieles vom Besten aus dem heutigen Musikleben in Konzert und Oper zu präsentieren, bedeutet diese Dimension der dauerhaft dokumentierten historischen Aufnahmen eine höchst reizvolle Vertiefung der künstlerischen Perspektive. Angesichts der großen Umbrüche im Musikleben und Musikmachen der letzten Jahrzehnte erlaubt die Vergegenwärtigung der großen Umbrüche auch schon früher anregende Rückschlüsse in viele Richtungen.
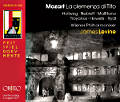
C 938 172 I
C 939 171 B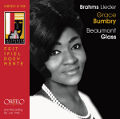
C 941 171 B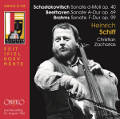
C 942 171 B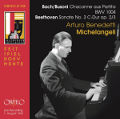
C 943 171 B
So ist es von herausragendem Interesse, nun erstmals das Solo-Debüt des damals 27-jährigen Daniel Barenboim mit einem reinen Beethoven-Programm nachhören zu können, der heute eine wandelnde Instanz des Musiklebens in so vielen Gattungen wie niemand sonst ist und trotz seiner „erst“ 74 Jahre auch von einer historischen Tiefe der Zeitgenossenschaft und Nachfolge älterer Traditionen wie kein anderer. Damals stand Barenboim jedoch erst am Anfang der Entfaltung seiner vielen weiteren Aktivitäten und auf dem Zenit einer noch mehr auf das Klavier konzentrierten Karriere. Innerhalb des im damaligen Musikleben stattfindenden Generationen-Umbruchs behauptet sich der Debütant glanzvoll und selbstbewusst, mit beachtlicher pianistischen Eloquenz, aber vor allem höchsten musikalischen Tugenden: der Fähigkeit zur Spannungserzeugung wie meditativer Verinnerlichung, weitestreichender Disposition, sehr großer Dynamikskala und verblüffender Gesanglichkeit, die einen heute noch in den Bann schlägt, beim atemberaubenden langsamen Satz von op. 10 Nr. 3 ebenso wie einer Waldstein-Sonate mit tollkühn weitgespanntem Finale und einer op. 111 mit himmlischen Längen in der Arietta.
Fünf Jahre früher trat zum ersten und letzten Mal der damals mit 45 Jahren schon legendäre Arturo Benedetti Michelangeli bei den Festspielen auf, und der ausnahmezustandhafte Sonderfall seines Auftritts zeigt sich auch daran, dass der Einzelgänger die Aufnahme und Übertragung der zweiten Konzerthälfte streng und erfolgreich untersagte. Es passt sicherlich mehr als bei jedem anderen Pianisten, dass eines der wenigen Bach-Stücke aus seinem öffentlich vorgeführten Repertoire die hier wiedergegebene Bach-Chaconne für Violine ist – ein Instrument, das Benedetti Michelangeli selber studiert hatte, und das er erklärtermaßen in seiner eigenen hochentwickelten Klaviertechnik versuchte nachzuahmen – hier in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni. Ohnehin ist es wieder einmal aufregend, wie verschieden die äußerst durchdachten Interpretationen des sehr begrenzten öffentlich dargebotenen Repertoires jeweils ausfallen, und wie keineswegs zurückhaltend, sondern durchaus extrem zupackend der Maestro sich zuweilen zu spielen erlaubte. Entwaffnend die Vollendung, mit der hier die brillante Beethoven-Sonate op. 2 Nr. 3 serviert wird, dabei draufgängerisch virtuos.
Eine der großen faszinierenden Sängerpersönlichkeiten ihrer Zeit war die Bayreuther „schwarze Venus“ Grace Bumbry, die ihren riesigen darstellerischen Ambitus bei den Salzburger Festspielen mit einer ebenso packenden Lady Macbeth des Wagner-Antipoden Verdi unter Beweis stellte (Orfeo C 843112), wie hier auf ganz anderem Terrain mit einem anspruchsvollen reinen Liedprogramm des Wagner-Antipoden Brahms; in einem liederabendfreundlicheren Klima als heutzutage, aber auch ein Jahrzehnt ante Jessye Norman.
Eine prägende, wahrhaft große Instrumentalistenfigur des Musiklebens ist gewiss der Cellist Heinrich Schiff gewesen, der letztes Jahr verstarb und nicht angemessen auf CDs repräsentiert ist. Hier ist er in seiner prallen, draufgängerischen Musikalität mit einem Partner von selten zu hörender Ebenbürtigkeit zu erleben, bei drei Hauptstücken des Cellorepertoires, der Sonate op. 40 von Schostakowitsch, und der mittleren von Beethoven sowie der letzten von Brahms.
Ein weiteres Monument unserer Zeit ist sicherlich der sehr große Opern-Dirigent James Levine. Hier ist er mit 34 Jahren in einer Ponnelle-Produktion von – passend zum diesjährigen Programm – Mozarts letzter Oper La clemenza di Tito zu erleben, in einer spannenden Umbruchzeit: kurz bevor stand damals der epochemachende Wandel, den wir mit dem Namen Harnoncourt verbinden und der bemerkenswerterweise mit Mozarts anderer „opera seria“ Idomeneo begann. Doch überzeugt und überwältigt „Jimmy“ Levine mit einer vitalen, „vollen“, klugen Darstellung, nicht zuletzt wegen eines absolut angemessenen Sängerensembles und bestens aufgelegten Wiener Philharmonikern, so dass man sich einmal mehr staunend fragt, ob es nicht doch vor der vermeintlichen „Rettung“ und „Wiederentdeckung“ schon sehr, sehr gute Aufführungen gab von solchen auch heute noch als herausfordernd geltenden Werken.
nach oben |
|

ORFEO
Chormusik & Oratorien
Edition zeitgenössisches Lied
Kammermusik
Lied
Musica Rediviva
Oper
Recital
Symphonie & Konzert
Weihnachten
ORFEO D'OR
Bayerische Staatsoper live
Bayreuther Festspiele live
Deutsche Oper am Rhein
Salzburger Festspieldokumente
Wiener Staatsoper live
Wiener Symphoniker
Dirigenten
Große Sänger d. 20. Jh.
Orchesterkonzerte
Quartette
Solisten
|